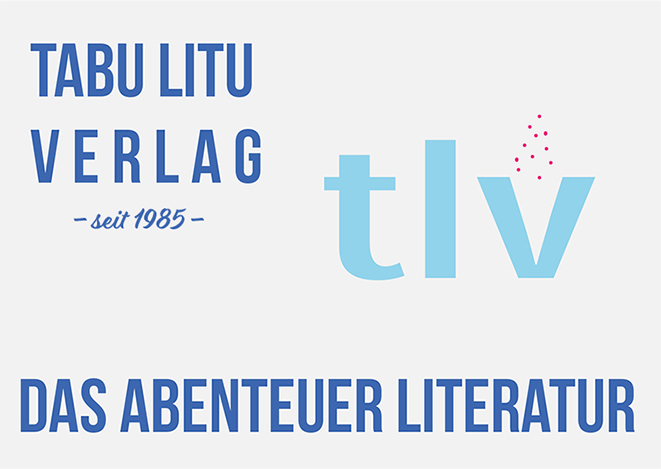Vorwort
Völlig unbeachtet von der literaturwissenschaftlichen Öffentlichkeit, vom Feuilleton ganz zu schweigen, jährte sich am 17. Januar 2023 Zacharias Werners Todestag zum 200. Male. „Kaum ein anderer Dichter der deutschen Romantik war zu seinen Lebzeiten so berühmt und zugleich berüchtigt wie Zacharias Werner. Er verkehrte in den auserlesensten Kreisen der Berliner Gesellschaft, an Fürstenhöfen und in literarischen Salons. Monatelang weilte er bei „Helios-Apollon“ (Goethe) und der „heiligen Aspasia“ (Madame de Staël), war Gast deutscher, polnischer und ungarischer Adelsfamilien. Auf der Bühne rivalisierte er mit Schiller, auf der Kanzel mit Abarahm a Santa Clara. In Warszawa ächzte er unter dem Joch der preußischen Bürokratie, in Wien eiferte er für die katholische Kirche. In Paris und Rom ergab er sich teils höchstem Kunst-, teils tiefstem Sinnengenuss. In Königsberg lebte er mit einer Dirne, in Podolien schwärmte er für eine Nonne. Er war Aufklärer und Romantiker, Rationalist und Mystiker, Protestant und Katholik, Freimaurer und Weltpriester. Er heiratete dreimal und wurde dreimal geschieden.“
Das schrieb Gerard Koziełek in „Friedrich Ludwig Zacharias Werner. Sein Weg zur Romantik“, das 1963 erschienen ist. Koziełek hat einige Bücher zum dramatischen Werk Zacharias Werners in Wrocław (Breslau) publiziert, die später auch auf deutsch erschienen; so u. a. sein Buch „Das Polenbild der Deutschen 1772-1848“ (1989). Was Koziełek 1963 beklagte, dass nämlich Werners Werk nie unvoreingenommen gesichtet und analysiert wurde, gilt nach wie vor. Dieser Versuch einer Roman-Biografie kann die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung natürlich nicht leisten oder ersetzen, aber im besten Falle anregen.
In einem SPIEGEL-Leserbrief aus dem Jahre 1951, in dem es um Tanztheater ging, hieß es: „Mit demselben Recht könnte man einen Maulwurfshügel mit dem Kilimandscharo, Zacharias Werner mit Shakespeare und die Courts-Mahler mit Thomas Mann vergleichen.“
So sinnvoll und notwendig die Unterscheidung zwischen Belletristik und Sachbuch, fiction und non-fiction, Literatur und Wissenschaft sein mag, die Behandlung mancher Gegenstände erfordert Grenzüberschreitungen, beziehungsweise die Komposition, die Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst. Das Leben Zacharias Werners bietet sich als ein solcher grenzüberschreitender Gegenstand an. Denn obwohl er im Leben geradezu idealtypisch das Klischee des zerrissenen und lebensuntüchtigen Romantikers verkörperte, wird er von der aktuellen Literaturwissenschaft kaum wahrgenommen. Ergänzt man jedoch sein literarisches Sujet, das heute sicher genauso umstritten wäre, um sein Ringen mit sich selbst, um seinen Kampf mit den widerstrebenden Kräften in ihm, die jedoch nicht nur individuell zu sehen sind, erhält man ein schillerndes Lebens- und Gesamtkunstwerk in einem sehr modernen Sinne.
Meine Klassifizierung „Roman-Biografie“ soll zeigen, dass hier der Versuch unternommen wird, eine Biografie abzuliefern, die ihrem Gegenstand, dem Leben Zacharias Werners, sowohl wissenschaftlich als auch literarisch gerecht wird. Mir geht es weder um eine Werksanalyse, noch um eine Charakterstudie. Gleichzeitig eröffnet diese Herangehensweise die Möglichkeit, sowohl das literarisch-wissenschaftliche wie belletristisch-interessierte Publikum anzusprechen. Ich bin der Meinung, dass sowohl die Tagebucheintragungen als auch die Briefe(1) Werners von wissenschaftlichem wie darüber hinaus von literarisch-künstlerischem Interesse sind; sie bilden das Fundament und die Säulen meiner Arbeit.
An diesen und ähnlichen Passagen, die man meist an der Datumsangabe erkennt, lässt sich ablesen, wie ich mit den Quellen umgegangen bin. Ich habe sie übernommen, manchmal ohne sie als Zitate kenntlich zu machen, sie aber in der Literaturliste aufgeführt. Ich habe sie zudem bearbeitet, beispielsweise indem ich von der Ersten Person Werners in die Erzählweise mit der Dritten Person wechsele, dabei notwendige Änderungen der Pronomina, sowie den Wechsel ins Präteritum vorgenommen habe.
Es gibt weitere Änderungen, Kürzungen und Ergänzungen, die mir angebracht schienen; Ergänzungen beispielweise aus korrespondierenden und wissenschaftlichen Quellen, die ich teils narrativ mit fiktionalen Elementen umgesetzt habe. Bei der Orthographie und Grammatik habe ich eingegriffen, ohne Werners Sprache und den Zeitgeist zu korrumpieren. Gleichzeitig habe ich mir bei meiner Orthografie die Freiheiten genommen, die sich auch Werner genommen hat. Ich sehe keine andere Möglichkeit, die historischen und intimen Details, die Werner in den Dokumenten präsentiert, ohne Verlust an Authentizität und Komplexität darzustellen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass diese Sprache und Orthographie (2) eine Herausforderung darstellen, sie führen aber zu einem langsameren und damit gründlicheren Lesen. Hat man sich einmal daran gewöhnt, erweitert sich das rein faktische, historische Wissen um eine intuitive Annäherung an die Denkweise der Zeit um die Wende 18. auf 19. Jahrhundert.
Ähnlich bin ich bei den Sekundärquellen, Biografien und Analysen, vorgegangen, die entweder zu Werners Lebzeiten oder später veröffentlicht wurden. Darunter eine Reihe Publikationen, die Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts erschienen und für Werners persönliche und literarische Bewertung nachteilig blieben.
Der Versuch einer Roman-Biografie genügt insofern literaturwissenschaftlichen Ansprüchen, als die biografischen und historischen Umstände und Ereignisse korrekt wiedergegeben werden. Dies geschieht allerdings auch narrativ und fiktionalisierend. Was ich auf jeden Fall vermeiden wollte, ist eine aus heutiger Sicht wertende Betrachtung. Es wäre jedoch naiv zu glauben, mein Bewusstsein des 21. Jahrhunderts ließe sich völlig abschalten; so wenig, wie ich im Heute Spuren des Bewusstseins des 18./19. Jahrhunderts übersehen kann.
In diesem Buch wird erneut deutlich, wie sehr die Romantiker-Generation miteinander vernetzt, verknüpft und verbandelt war. Man könnte von einem Stagecoach-Set sprechen, von einer Künstlergeneration (vgl. Register und Kurzbiografien), die in Postkutschen unterwegs war und in wechselnden Konstellationen in Weimar und Wien, Berlin und Paris, Coppet und Rom, um einige wenige Orte zu benennen, zusammenfand. Schillernd zwischen aufkommendem Nationalbewusstsein im zerfallenden Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und erwachendem europäischen und cosmopolitischen Bewusstsein (vgl. P. Kleingeld: Six Varieties of Cosmopolitism in Late Eighteenth-Century in Germany, 1999). Mit künstlerische Karrieren zudem, die sich in dem professionalisierenden Literaturmarkt behaupten mussten.
Die auch heute noch beliebte Frage: „Können Sie denn davon leben?“, hätte Werner mit „teilweise“ beantwortet. Er war von Hause aus vermögend, sparsam, und verdiente eine Zeitlang als preußischer Beamter dazu. Goethe, der ja als Minister nicht darauf angewiesen war, war auch hier die große Ausnahme. Aber außer in den Zeiten, kurz nach Erscheinen von Bestsellern wie „Die Leiden des jungen Werthers“, die den ohnehin wohlhabenden Goethe reicher machten, dürften sich die Tantiemen überschaubar gestaltet haben. Erste Urheberrechtsvereinbarungen gab es zuerst in Frankreich, ab 1837 auch in Preußen. Werner musste erleben, dass in Wien sowohl Theater als auch Verleger ihn nicht enstprechend vergüteten; Honorare wurden nicht immer gezahlt und auch Raubkopien wurden in Umlauf gebracht. Letztlich waren viele Künstler auf die Gunst des regierenden Adels angewiesen. Dass Zacharias Werner Lebenszeit in Königsberg, damals preußisch, heute russische Enklave (Polen will ab 2024 wieder den polnischen Namen verwenden: Królewiec), Warschau in Polen, Berlin, Coppet in der Schweiz, Rom in Italien, Kamieniec in Podolien, heute auf dem Gebiet der Ukraine und Moldawiens, und Wien in Österreich verbrachte, macht die Sache nicht einfacher.
Gerhard Schulz schrieb über Werner in „Romantik. Geschichte und Begriff“ (1994): „Alles, was Freund und Feind des Romantischen sich darunter vorstellen, schien sich in ihm zu vereinigen: christliche Frömmigkeit bis zum Märtyrertod, heidnische Mythen und Riten, Liebe als Sexualität, Schwärmerei und Caritas, Geheimgesellschaften sowie nicht-klassische Formkunst. Diejenigen aber, die sich gar nichts unter dem Romantischen vorstellen konnten, bekamen von ihm Leichtverständliches und zugleich scheinbar Anspruchsvolles zu diesem Thema geliefert, was das gute Gefühl verschaffte, an Neuem und Originellem teilzuhaben, ohne dessen Herausforderung annehmen zu müssen, zugleich aber den Vorwurf der Lust am Trivialen von sich weisen zu können.“
Die Quellenlage für mein Vorhaben war völlig ausreichend, obwohl es keine bearbeitete und kommentierte Neuauflage seiner Werke gibt. Allerdings sind fast alle Veröffentlichungen Werners als Digitalisate im Internet und als Reprints, also eingescannte Originalausgaben, in durchaus unterschiedlicher Qualität (kopierte Scans) und zu stark varierenden Preisen erhältlich. Im Antiquariat konnte ich einige Stücke Werners in den ersten Auflagen, die Anfang 1800 bei Sander in Berlin oder auch in Wien erschienen, zu moderaten Preisen erstehen. Man ist heute überrascht, wie kleinformatig die Bücher damals waren, etwa Reclam-Format, das ja aus dieser Zeit stammt.
„Today Zacharias Werner (1768-1823) is all but forgotten. Yet if we discount Tieck’s only successful play, Der gestiefelte Kater, the author of the colossal masonic tragedy Die Söhne des Thals, the thrilling tragedy of fate Der 24. Februar, and the highly topical gender tragedy Wanda, Königin der Sarmaten was by far the most gifted dramatic writer among the German Romantics and the only one to conquer the contemporary stage.“
Das schreibt Nicolas Saul in seinem Aufsatz The Body, Death, Mutilation, and Decay in Zacharias Werner (German Life and Letters 52:2 April 1999), eine relativ junge Publikation zu Zachrias Werner. Saul weiter: „Here the attitude of the Romantic dramatist Zacharias Werner to death and the body is analysed for the first time.“
Das wiederum ist nicht ganz richtig, denn Hildegard Dauer hat sich in ihrer Inaugural-Dissertation „Das Todesproblem bei Ludwig Zacharias Werner“ (1946 an der Johann Wolfgang-Goethe Universität-Frankfurt am Main) sehr wohl damit befasst. 1975 hat Colin Walker den Aufsatz „Zacharias Werner and the „Martyrdom“ of Abraham“ (in The Modern Language Review) veröffentlicht.
Ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Werners Stücken hat es vor allem am Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts gegeben, verwiesen sei beispielsweise auf Paul Hankamers „Zacharias Werner – ein Beitrag zur Darstellung des Problems der Persönlichkeit in der Romantik“ von 1920. Der aber, wenn auch nicht als einziger, Werner mit Vorurteilen begegnete, und von der „slawischen Bedientenhaftigkeit“ seines Wesens sprach: Nicht wenig später war dann von seiner „ostisch-ostbaltischen Rassenseele“ und der „ostisch-slawischen Veranlagung“ des „verpolten Deutschen“ die Rede.
Außer Vorurteilen und Fehleinschätzungen gab und gibt es auch völlig falsche Behauptungen. Im Biographischen Lexikon des Kaiserthums Oesterreich von 1887, dessen Online-Version laufend bearbeitet wird (zuletzt 18. Januar 2022; zuletzt aufgerufen am 18. Dezember 2023), heißt es, „Wanda, Königin der Sarmaten“ sei 1813 in Rom entstanden, dabei wurde die Tragödie bereits 1808 in Weimar unter der Regie Goethes aufgeführt. In der gleichen Quelle heißt es: „Werner’s Uebertritt zum Katholizismus hat seinen Dichterruhm völlig vernichtet, und doch ist Werner als dramatischer Dichter Goethe und Schiller ebenbürtig. Seine Dramen sind trotz ihrer formellen Gebrechen Schöpfungen eines gewaltigen Dichtergeistes und wurden nur von der protestantischen Kritikerclique Norddeutschlands mit Unrecht zurückgedrängt.“
Hankamer gibt ein weiteres Beispiel problematischer Biografie: „Rasch fand Werner den Anschluss an die römische Gesellschaft und wieder beginnt ein auf- und niederwogendes Leben, das ihn von einem Genuss in den andern warf, durch Bordell, Museum, Kirche, Künstleratelier in wirrer, alles vergessenmachender Schnelle führte. Jäh wechselnde Gefühle flackerten auf. Dann und wann wurde der narkotische Taumel von blitzartig wirkenden Ausbrüchen des Ekels und der Selbstverachtung durchbrochen. Verzweiflung ließ den tollen Tanz aufführen.“ Liest man die Tagebucheintragungen heute, so empfinde ich, vor allem bei Werners zweitem Rom-Aufenthalt, fast so etwas wie heitere Gelassenheit bei ihm.
Zwei weitere Dissertationen befassen sich mit Werners Stücken. Yixu Lü „Frauenherrschaft im Drama des frühen 19. Jahrhunderts“ von 1993, die Werners Wanda mit Brentanos „Die Gründung Prags“, Grillparzers „Libussa“ und Kleists „Penthesilea“ vergleicht. Beatrice Osdrowski legte 2004 ihre Dissertation unter dem Titel „Die Brüder Schlegel und die ’romantische’ Dramatik – Ein typologischer Vergleich von Theorie und Praxis des ’romantischen’ Dramas in Deutschland und Spanien“ vor, die 500 Seiten umfasst, knapp vierzig davon zu Werners Wanda. Auch Osdrowski beklagt, dass Werners Stücke, bis auf den Vierundzwanzigsten Februar, von der Literaturwissensschaft ignoriert werden.
„Werners Wanda, Königin der Sarmaten setzt die ’romantische’ Dramenästhetik der Schlegel-Brüder insbesondere in formal-äußerlichen Aspekten eindrucksvoll und überzeugend um. Auch die zentrale und individuell geprägte Liebesthematik sowie das dem Schauspiel zugrundeliegende kosmogonische Weltbild weisen das Drama, das zwölf der insgesamt vierzehn Merkmale des in Kapitel 2 entwickelten Merkmalkatalogs der frühromantischen Dramenpoetik erfüllt, als ’romantisch’ aus. Andererseits aber fehlt es ihm an einem wahren dramatischen Konflikt sowie an ’romantisch’ Geheimnisvollem.“ Symbole und Bilder ließen das Stück als ’romantisiertes’ Trivialdrama erscheinen, rücke es in die Nähe von Melodrama und Oper, so Osdrowski.
Im 1904 erschienen Buch „Zacharias Werners Weihe der Kraft. Eine Studie zur Technik des Dramas“ schrieb Jonas Fränkel in seinem Vorwort: „Zacharias Werner wird für gewöhnlich als der Hanswurst der deutschen Literatur behandelt. Selbst die wenigen Literaturgeschichten, die aus erster Hand gearbeitet sind, betrachten ihn fast ausschließlich als den Vater des Schicksalsdramas und gehen über sein sonstiges Schaffen mit bequemem Achselzucken und nichtssagenden Gemeinplätzen hinweg. Und doch hätte man an die Worte Grillparzers denken sollen: „Werner war der Anlage nach bestimmt, der dritte große deutsche Dichter zu sein, er mußte viel dagegen arbeiten, um sein Geburtszeugnis unwahr zu machen.“ Und man hätte ihn, denk’ ich, schon eines solchen gewichtigen Urteils wegen als Schaffenden ernster nehmen sollen.“
Als Motto seiner Publikation wählte Fränkel ein Goethe-Zitat von 1808, an Eichstädt: „Werners Talent müßte man erst vollkommen Gerechtigkeit widerfahren lassen, und sodann den unerlaubten Mißbrauch rügen, den er davon macht.“ Dass Goethe ziemlich verärgert war, als Werner bei seinem zweiten Besuch in Weimar ausgerechnet bei der Geliebten des Herzogs wohnte, der Schauspielerin Jagemann, die Goethe schließlich als Theaterleiterin ablöste, und viermal die Woche mit dem Herzog speiste, dürfte Werner beim Meister nicht beliebter gemacht haben.
Wie stark der Einfluss der Skandalisierung seines Lebenswandels und die eigene Diskreditierung seiner Werke, „Weihe der Unkraft“, auf die Rezeption des Wernerschen Werkes hatte, ist schwer abzuschätzen; auf gewisse Art und Weise hatte er selbst sich schon zu Lebzeiten nicht nur zu einem obsoleten, sondern gescheiterten Autoren gemacht, machen lassen. Das zusammen mit dem Umstand, dass auch seine Werke umstritten waren, ist nicht die beste Voraussetzung für eine unvoreingenommene Auseinandersetzung unter rein literarischen Gesichtspunkten. Werner ist ganz sicher, was das ohnehin problematische Verhältnis von Leben und Werk angeht, ein Präzedenzfall.
Das Verhältnis zwischen Goethe und Werner ist vielfach beleuchtet und erörtert worden, dass nämlich Werner Goethe über alles verehrte, dass Goethe in Werner große Hoffnungen setzte, die sich aber letztlich nicht erfüllten, weil Werner nicht von seinem Mystizismus, seinem System der Liebe abweichen wollte, i. e. konnte. Betrachtet man die zwei längeren Zeiträume, in denen die beiden miteinander zu tun hatten, weiß man, dass sie nicht nur in den literarisch-gesellschaftlichen Cirkeln verkehrten, in denen vorgelesen, gedichtet und diskutiert wurde, Theater besucht und gefeiert wurde, sondern dass sie sicher auch Gespräche unter vier oder sechs Augen führten. Die Zeiträume, um die es geht, in denen Goethe also zwei Werner-Stücke in Koproduktion mit ihm zur Aufführung brachte, schrieb Goethe an den Wahlverwandschaften.
Der Roman schildert das tragische Schicksal zweier Paare, die auch über Kreuz nicht glücklich werden können. Die am Ende auftretende christliche Märtyrerin und das Motiv der Entsagung haben zu Anwürfen geführt, dass Goethe hier romantischer sei als die Romantiker. Ob und welchen Einfluss Werner und seine Werke dabei spielten, müsste untersucht werden, ist hier aber nicht zu leisten.
„Zacharias Werner, der mit seinem dritten, dem Kreuz an der Ostsee folgenden Drama über Martin Luther 1806 einen gewaltigen Bühnenerfolg feierte, blieb seinen Zeitgenossen vor allem als Kuriosum, als exaltierter Prediger auf dem Wiener Kongress und übereifriger Konvertit in Erinnerung, nicht als Dichter herausragender, innovativer Dramen; nach seinem Tod wurde er rasch vergessen. Daran könnte sich nun etwas ändern, denn Günter de Bruyn, der sich schon seit längerer Zeit einen Namen als Biograf von Randfiguren der preußischen Geschichte gemacht hat, legt unter dem Titel Sünder und Heiliger im S. Fischer Verlag eine bestens lesbare Biografie Werners vor, die dessen „ungewöhnliches Leben“ (so der Untertitel) mit großem Wohlwollen und ruhiger Stimme erzählt.“ (3)
Günther de Bruyn: „Sünder und Heiliger – Das ungewöhnliche Leben des Dichters Zacharias Werner“ von 2016. Das Buch war also rechtzeitig vor Werners 250. Geburtstag 2018 auf dem Markt, aber offenbar ohne allzu große Wirkung. Meine Recherchen (u. a. Google news und Google scholar) haben nur wenige weitere Resultate ergeben: Deutschlandfunk oder auch Eulenfisch Literaturblog; und obwohl de Bruyn 2016 90 Jahre alt wurde, was eine ordentliche Presseresonanz (FAZ, SPIEGEL etc.) nach sich zog. Das Buch ist in Deutschland und Österreich in einigen, vor allem auch von katholischen Einrichtungen unterhaltenen, Bibliotheken vorrätig, wenn auch nicht flächendeckend (4). Zumindest zwei einschlägige Romantik-Publikationen haben de Bruyns Biografie rezensiert: Steffen Höhne im Internationalen Jahrbuch der Bettina-von-Arnim-Gesellschaft (Bd. 28/29) und Thomas Meißner im Band 27 des Athenäum.
De Bruyns Biografie hat offenbar keine Neuauflage erlebt; sie ist aber hervorragend recherchiert, sehr kompetent und gut lesbar, kann allerdings mit etwas mehr als 200 Seiten und kleinem Buchformat die vielen unterschiedlichen Lebensstationen Werners nur bedingt in ihrer Divergenz darstellen; das durchaus umfangreiche Gesamtwerk wohl auch nicht. Johannes Schmidt (literaturkritik.de, s. Fußnote S. 16) wirft de Bruyn vor, er reformuliere oft „alte, harsche Urteile.“ Für mich war sein Buch dennoch ein wichtiger Zugang zu sehr ergiebigen Quellen (vgl. de Bruyns Literaturliste), ohne die ich mit diesem Buch nicht so schnell vorangekommen wäre.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung. An einer Stelle zitiert de Bruyn eine kurze Passage aus Caroline Pichlers Lebenserinnerungen; sie schrieb, dass Werner Obst verabscheute. Er könne keine Frau küssen, wenn sie vorher einen Apfel gegessen hätte. Ich habe die Passage komplett übernommen, weil Pichler von Werners Aufnahme in der Wiener Gesellschaft berichtet und sich zu seinen Stücken äußert; weil sie, die mit Goethe und vielen Frühromantikern persönlich bekannt war, sich zudem auch zur „Neuen Schule“ positionierte.
Es ist leicht nachzuvollziehen, warum in Weimar ein Denkmal für Goethe und Schiller steht, warum die Universität in Frankfurt Goethes Namen trägt, warum es in Marbach das Schiller-Nationalmuseum gibt. Wer in Königsberg, in Warschau, in Berlin, in Weimar, in Coppet, in Rom, in Kamieniec oder in Wien sollte sich verantwortlich fühlen, Friedrich Ludwig Zacharias Werner zu gedenken? Das Gleiche gilt für viele Frühromantiker wie die Schlegel-Brüder: Sie waren alles andere als seßhaft und auch in ihren Schriften nicht leicht zu fassen. Nicht von ungefähr ist die neue Raumerfahrung ein wesentliches Motiv der Romantik.
Jede zusammenfassende Darstellung ist tendentiell wertend. Man kann Werners Reisen Pilger- oder Bildungsreisen nennen, oder man kann sie als Fluchten, als Ausdruck seiner Ruhe- und Heimatlosigkeit erkennen. Immerhin startete Werner viele seiner Reisen, ohne einen festen Wohnsitz zu haben; Post ließ er dann unter fremden Adressen hinterlegen. Und er reiste nicht nur, sondern war häufig über längere Zeiträume hinweg, ein, offensichtlich gern gesehener, Gast in vielen Häusern. Ich bin einen anderen Weg gegangen, indem ich seine Reisen anhand der Tagebücher und Briefe ausführlich abbilde; man kann so eine eigene Einschätzung finden. Liest man die Reiseberichte Werners, erkennt man, so glaube ich, dass Reisen überhaupt und an sich etwas ganz anderes bedeutete, als das, was wir uns heute spontan darunter vorstellen. Überhaupt ist es fraglich, ob man von Werners Wanderjahren sprechen kann, ist er doch, nachdem er seine Heimatstadt Königsberg als junger Mann einmal verlassen hatte, nirgendwo länger als ein paar Jahre geblieben. Er war immer unterwegs.
Und wenn in den Biografien zu lesen ist, Werner reiste durch Frankreich, die Schweiz und Italien, so erzeugt auch das falsche Vorstellungen. Zum Französischen Kaiserreich gehörten nicht nur die linksrheinischen deutschen Gebiete, sondern auch Genf, Genua und Parma. Der König von Italien beherrschte lediglich den Norden mit Mailand, Verona und Venetien. Das Königreich Bayern reichte bis Vorarlberg und nach Trient hinunter. Im italienischen Stiefel gab es außer ein paar kleinen Fürstenthümern das Königreich Etrurien, den Vatikanstaat, den Napoleon entmachtet hatte, und das Königreich Neapel. Napoleon selbst hatte sich zum König von Rom gemacht. Der nichtfranzösische Teil der Schweiz war die Helvetische Republik, die Republik Wallis und das Fürstentum Neuchâtel.
Zu guter Letzt will ich meinen eigenen Band „Romantische Liebe – So reich an Freud ihr Schatten“ (2023) erwähnen, in dem ich fünf Autoren versammele: Franz von Baader, Karl-Friedrich Forberg, Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr, Friedrich Schleiermacher und Zacharias Werner, sie biografisch vorstelle und ihre wichtigsten Aufsätze und Texte zur Liebe in der Romantik. Während der Arbeit an dem Buch wurde der Gedanke, sich mit Werner eingehender zu befassen, immer stärker. Ich hoffe, man kann das nach der Lektüre dieses Buches nachvollziehen.
Auch meine beiden Bücher, „Göttern und Menschen zum Troz – Ein Roman mit zahlreichen freien Adaptionen und Modificirungen div. Quellen“ und „Enstelltes Chaos glänzender Getsalten – Die Frauen in August Wilhelm Schlegels Leben“ können weitere Hinweise e. g. zu den vielfältigen personellen Verknüpfungen geben.
Saul nennt Wanda eine „highly topical gender tragedy“. Ich denke, dass die Aspekte Liebe und Sexualität, wie auch die des Todes und Märtyertums u. a. heute eine andere Erörterung erhielten als die überwiegend moralische Empörung der damaligen und der Kritik des frühen Zwanzigsten Jahrhunderts; vielleicht schon wieder Empörung, wenn auch unter anderen Vorzeichen: ideologisch moralisierend. Es ist ja bekannt, dass die Einstellung zum und die Auffassung vom Tode (von der Geschlechtlichkeit ganz zu schweigen) sich im Laufe der Menschheitsgeschichte und in den verschiedenen Kulturen sehr divergierend darstellen.
Selbst Werners Mystizismus erschiene heute im Lichte der Fantasy-Bewegung, ließe man den Catholicismus außen vor, etwas anders als zur Zeit Werners, also die Zeit der Aufklärung und der Romantik; beides wichtige Elemente in Werners Leben und Schaffen. Auch wenn Werners Stücke sich mit einer weit zurückliegenden Vergangenheit beschäftigen, der Geschichte Preußens und Polens, mit den Sarmaten in der heutigen Ukraine, den Kreuzrittern, Attila und Kunigunde, sowie den Makkabäern, der jüdischen und syrischen Geschichte, ahnen wir vielleicht, dass Vergangenheit nicht einfach vergangen ist.
Werner veranschaulicht das oft schwierige und keineswegs eindeutige Verhältnis der beiden Elemente Leben und Werk und wirft Fragen auf wie: Ist ein anständiges, Gott gefälliges Leben, was Menschen für anständig und Gott gefällig halten, tödlich für künstlerische Kreativität? Bedarf die künstlerische Kreativität schwerer Defizite und Differenzen im Leben? Muss die Entscheidung immer lauten: Perfection in life or in art? Hinterfragen könnte man auch, ob religiös motivierte Schriften grundsätzlich als nicht-literarisch zu erachten sind.
Die in der Literaturliste und im Vorwort exemplarisch vorgestellten Publikationen und Meinungen von Werners Zeitgenossen werden im Hauptteil meiner Arbeit deutlicher werden. Was danach, Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts und heute, verfasst und geäußert wurde, habe ich, wenn auch nicht zu einhundert Prozent, zur Kenntnis genommen, ist aber nicht Gegenstand der erzählten Biografie, die damit den Stand etwa zur Zeit der Herausgabe „Zacharias Werners sämmtliche Werke/Aus seinem handschriftlichen Nachlasse herausgegeben von seinen Freunden (Einzige rechtmässige Originalgesammtausg. in 13 Bänden)“, Grimma, vermutlich 1840-1844, reflektiert. Das bedeutet einerseits auch, dass ich den Zeitgenossen damals vertraute Begriffe wie Hauderer oder Diligence, beides (Post)Kutschen, nicht erläutere, andererseits Begriffe, die uns heute vertraut sind, wie offene Ehe für eine Beziehung, nicht verwendet werden.
Heines „Die Romantische Schule“ von 1833 passt auch in diesen zeitlichen Rahmen. Mit Werner geht er nicht weniger kritisch und polemisch um als mit den anderen Romantikern: „Zacharias Werner trieb das Ding so weit, wie man es nur treiben konnte, ohne von Obrigkeits wegen in ein Narrenhaus eingesperrt zu werden. [...] Der Geist Werners trug nun, sein ganzes Leben hindurch, das Muttermal dieses religiösen Wahnsinns. Die entsetzlichste Religionschwärmerei finden wir in allen seinen Dichtungen. Eine einzige, »Der vierundzwanzigste Februar«, ist frei davon und gehört zu den kostbarsten Erzeugnissen unserer dramatischen Literatur. Sie hat, mehr als Werners übrige Stücke, auf dem Theater den größten Enthusiasmus hervorgebracht. Seine anderen dramatischen Werke haben den großen Haufen weniger angesprochen, weil es dem Dichter, bei aller drastischen Kraft, fast gänzlich an Kenntnis der Theaterverhältnisse fehlte. [...] Genau betrachtet, ist sich der Mann immer konsequent geblieben, nur daß er früherhin bloß besang, was er späterhin wirklich übte.“
In der Werkauswahl habe ich, um wenigstens einen Einblick in sein literarisches Schaffen zu ermöglichen, Beispiele und Auszüge versammelt, von den frühen Gedichten, über seine Theaterstücke bis hin zu seinen Predigten. Bei den häufig sehr langen Theaterstücken, die sich im Buchdruck von den tatsächlich gespielten Texten meist unterscheiden, habe ich mich auf einzelne Szenen oder Akte beschränken müssen. Szenarien wäre sicher hilfreich, hätten jedoch den Rahmen gesprengt.
Da viele der Wernerschen Gedichte sehr lang sind, habe ich auch hier Kürzungen vorgenommen, um wenigstens die thematische Vielfalt andeuten zu können. Aus den umfangreichen Bänden mit Geistlichen Gedichten, Disputa und Predigten habe ich mich auf einige wenige Beispiele beschränkt. Die drei Predigtbände sind fast 600 Seiten stark; ich habe eine Predigt ausgesucht, nämlich die zum Sonntag Septuagesima aus der Vorfastenzeit. Werners Predigten während des Wiener Kongresses sind meines Wissens nicht dabei. Man sieht, oder ahnt, wenn man kein Kirchgänger ist, dass die Länge der Predigten das heutige Maß überschritt.
Werners Aufsatz über das menschliche Leben, der vermutlich in einem Brief an Christian Schlosser verfasst wurde, findet sich nach den Gedichten und vor den Auszügen aus seinen Theaterstücken.
Ich habe die Auszüge nach der Reihenfolge der Gesamtausgabe in 13 Bänden geordnet, die im Verlags-Comptoir in Grimma ab ca. 1840 von seinen Freunden herausgegeben wurde, so dass man sie gut parallel zur Biografie lesen kann. Die Zusammenstellung ist nicht repräsentativ, sondern subjektiv-selektiv. Da jedoch kaum mit einer umfassenden Neuauflage seines Werks in naher Zukunft zu rechnen ist, habe ich meine Auswahl, wie ich hoffe, angemessen umfänglich kollationiert.
Weil ich mich in der Roman-Biografie auf die Lebenszeit Werners und einige wenige Publikationen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschränke, also alles, was seit Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen ist, weglasse, ich aber dennoch die Rezeption seiner Werke bis heute, die ja nicht so umfrangreich ist, nicht ganz ausklammern wollte, habe ich das Vorwort so ausführlich angelegt. Denn Werner ist die Prominenz des (früh)romantischen Dramas. Prominenz in unserem heutigen Verständnis von Celebrity, er verwendet selbst das Wort Celebrität für sich, samt den dazugehörigen Skandalen, aber vor allem ist er es mit seinem dramatischen Werk, auch wenn man nicht der Einschätzung des Biographischen Lexikons des Kaiserthums Oesterreich von 1887 folgen mag, er sei Schiller und Goethe ebenbürtig. Größe mag aus ihrer Substanz heraus groß sein, sie muss aber auch gemacht werden. Denn wie sollte sie ohne äußere Anerkennung sichtbar werden?
Johannes Schmidt endet seine Rezension der Werner-Biografie de Bruyns mit diesen Worten: „Nicht nur für die Literaturgeschichtsschreibung wäre es ein Gewinn, den dritten Mann neben Schiller und Kleist wiederzuentdecken.“ Dem kann ich mich nur anschließen und hoffen, dass diese Publikation einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann, das Werk Zacharias Werners ohne all die, teilweise von Werner selbst verschuldeten, Misskonzeptionen auf seine Wertigkeit im damaligen und heutigen wissenschaftlichen Kontext, der ja auch nicht frei von Präsumptionen (5) sein wird, zu untersuchen.
Ich danke der Universitätsbibliothek der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Repro-Scan des Eichendorff-Zitats auf Seite 167f. Bei meiner Arbeit an diesem Buch standen mir weder Hilfskräfte, noch fachlicher Rat, noch irgendeine Art der finanziellen Förderung zur Verfügung, aber das immer ergiebiger werdende Internet.
Deshalb der generelle Dank an alle Universitätsbibliotheken und andere Einrichtungen, die sich die Mühe machen, Originalquellen einzuscannen und im Internet allgemein verfügbar zu machen.
So richtig und wichtig es ist, historische Ereignisse, Personen und geistige Sachverhalte immer wieder nach den jeweils neuesten Erkenntnissen und mit den aktuellen Methoden und Konzepten zu untersuchen und zu interpretieren, sollte man sich dennoch darüber im Klaren sein, dass man der Wahrheit im Sinne der komplexen Faktizität des jeweiligen historischen Kontextes nicht notwendiger Weise näher kommt. Was jedoch keineswegs den Erkenntnisgewinn für die unsere eigene Zeit schmälern muss. Wenn man also heute neue Erkenntnisse verkündet, sollte man sich, denke ich, bevor man weitreichende Konsequenzen daraus fordern will, bewusst machen, dass die Zukunft Überraschungen, die neue und unerwartete Konsequenzen zeitigen werden, im Köcher hat.
Mit diesen allgemeinen Betrachtungen, meinem eigenen Erkenntnisgewinn aus der Beschäftigung mit Zacharias Werner, seinem Werk und seinen Zeitumständen, möchte ich meine einleitenden Worte schließen, die im eigentlichen Sinne begleitende Worte sind, denn ich habe von Anbeginn meiner Arbeit an der Biografie auch am Vorwort gearbeitet, das sich von einigen wenigen Sätzen und sicher mehr als einhundert Überarbeitungen bis heute entwickelt hat.
Klaus-Dieter Regenbrecht
Koblenz, 24. Februar 2024
(1) Ich darf auf eine aktuelle Veröffentlichung verweisen: Soziales Medium Brief: Sharen, Liken, Retweeten im 18. und 19. Jahrhundert; neue Perspektiven auf die Briefkultur / für die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hrsg. von Markus Bernauer ... – Darmstadt: wbg Academic, 2023, die die herausragende und vielfältige Bedeutung des damaligen Briefverkehrs herauszuarbeiten versucht.
(2) Man bekommt vielleicht auch eine Ahnung davon, dass es oft weniger die Sprache ist, die sich ändert, sondern der Sprachgebrauch. Dreißig Jahre nach Werners Tod kam Ferdinand de Saussure (1857-1913) zur Welt, der in seinen Vorlesungen mit der Unterscheidung von langage, langue et parole die moderne Linguistik begründete.
(3) https://literaturkritik.de/bruyn-suender-heiliger-dritte-mann-guenter-de-bruyn-zeichnet-dichter-zacharias-werner-als-suender-heiliger,22753.html aufgerufen am 18. Dezember 2023.
(4) https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0/ aufgerufen mit Name und Titel am 18. Dezember 2023.
(5) Seit die Romantik wissenschaftlich erforscht und analysiert wird, haben sich die Ansätze dazu, wie auch auf anderen Feldern, permanent geändert. Vgl.: https://www.academia.edu/en/35381309/FORUM_The_Study_of_German_Romanticism_in_the_21st_Century, aufgerufen am 31. Dezember 2023: „To think about the study of German Romanticism after the year 2000 means to think about Romanticism in the curious postregnum of “Theory” and in the age of interdisciplinarity. It seems to me that what primarily characterizes the study of Romanticism today, and did so for about two decades, is not what is done, but what is not done.” Guter Ansatz, mit Werner das zu tun, was bisher nicht getan wurde.
© 2024 by Klaus-Dieter Regenbrecht
|